Systematisches Versagen bei Xbox? Ex-Mitarbeiter packt aus über Entlassungen, Lügen und KI als Vorwand
Das Beben bei Microsoft und der Xbox-Sparte, das mit der Streichung von über 9.000 Stellen und der Einstellung von Projekten wie Perfect Dark begann, erhält eine neue, düstere Dimension. Während die offizielle Kommunikation von "Neuausrichtung" sprach, erhebt nun Trevor Nestor, ein ehemaliger Senior-Mitarbeiter, in einem detaillierten Bericht schwere Vorwürfe. Die Rede ist nicht mehr nur von Stellenabbau, sondern von systematischem Gaslighting, unethischen Praktiken und einer Kultur der Angst, die weit über die Gaming-Sparte hinausgehen. Die neuen Enthüllungen zeichnen das Bild eines Konzerns, dessen interne Realität im krassen Widerspruch zum polierten öffentlichen Image steht.

"Stärker denn je"? Die Fassade hinter den Entlassungen bröckelt
Noch immer hallen die Worte von Xbox-Chef Phil Spencer nach, der die Entlassungen mit dem Ziel einer "agileren" und "erfolgreicheren" Zukunft begründete, während die Xbox-Sparte angeblich Rekorde brach. Doch neue Informationen entlarven diese Darstellung als bestenfalls beschönigend.
So wurde behauptet, man wolle vor allem Management-Ebenen abbauen ("flatten management"). Öffentlich zugängliche Daten zeigen jedoch, dass in Microsofts Heimatstaat Washington nur 17 % der gestrichenen Stellen dem Management zuzuordnen waren. Die Mehrheit der Entlassenen waren also reguläre Mitarbeiter und Entwickler.
Gleichzeitig wird bekannt, dass Microsoft seine Lobby-Anstrengungen für das H-1B-Visaprogramm massiv verstärkt hat, mit dem ausländische Fachkräfte in die USA geholt werden. Die Daten zeichnen ein besonders drastisches Bild dieser Diskrepanz: Für jede einzelne Stelle, um die Microsofts Belegschaft in den USA zwischen 2021 und 2024 netto anwuchs, beantragte der Konzern im Schnitt mehr als fünf H-1B-Visa für ausländische Fachkräfte.
Anders ausgedrückt: Während Microsoft öffentlich einen Mangel an heimischen Talenten beklagt, übersteigt die Zahl der Einstellungsgesuche für ausländische Mitarbeiter die Zahl der tatsächlich neu geschaffenen Arbeitsplätze um ein Vielfaches. Dies nährt den Verdacht, dass es weniger um einen Fachkräftemangel geht, als vielmehr darum, Lohnkosten zu drücken.
Die KI als Vorwand: Wenn das Werkzeug versagt und zur Waffe wird
Microsofts öffentliche Strategie ist klar: Alles auf KI. CEO Satya Nadella treibt die Integration von KI-Tools wie Copilot in alle Unternehmensbereiche voran. Intern scheint die Realität jedoch eine andere zu sein. Der ehemalige Mitarbeiter berichtet von KI-Werkzeugen, die für komplexe Aufgaben, insbesondere im sicherheitsrelevanten Bereich, völlig unbrauchbar seien und oft nur "verstümmelten Unsinn" produzierten.
Die angebliche Leistungsfähigkeit der KI wird demnach zum Vorwand, um menschliche Mitarbeiter unter Druck zu setzen und letztlich zu entlassen. Dieses Vorgehen wird durch externe Studien untermauert, die der aktuellen Generation von KI-Agenten eine alarmierend hohe Fehlerquote bescheinigen.
Die ernüchternde Realität der KI-Leistung:
- Eine Analyse von Attila Hajdu ergab, dass autonome KI-Agenten bei ihren zugewiesenen Aufgaben in durchschnittlich 62 % der Fälle versagen.
- Forscher der Carnegie Mellon University stellten bei typischen, mehrstufigen Geschäftsaufgaben sogar Fehlerquoten zwischen 70 % und 90 % fest.
- Eine Salesforce-Studie meldete bei CRM-Szenarien eine Erfolgsquote von nur 35 %, was einer Fehlerquote von 65 % entspricht.
Die KI dient in diesem Kontext nicht nur als unzureichender Produktivitäts-Booster, sondern auch als Instrument des Managements: als Werkzeug zur Überwachung, als Mittel zum Gaslighting und als Quelle für eine plausible Leugnung von Verantwortung, indem die Schuld für Verzögerungen auf die angebliche "Performance" des Mitarbeiters geschoben wird, anstatt auf die Dysfunktionalität der Tools und Prozesse.
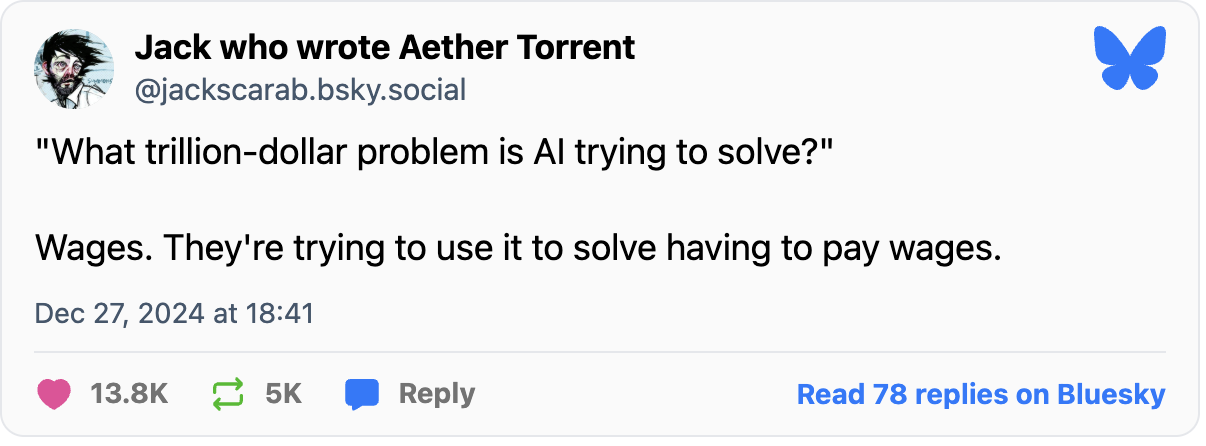
Quelle: Bsky
Eine Kultur der Angst: Einblicke in den Microsoft-Alltag
Der Bericht zeichnet das Bild eines toxischen Arbeitsumfelds. Von neuen Mitarbeitern wird erwartet, sich per "self-learning" einzuarbeiten, während die dafür notwendige Dokumentation veraltet, irreführend oder schlicht nicht existent ist. Anfragen nach Hilfe werden ignoriert oder später gegen den Mitarbeiter verwendet. Dies führt zu einer Kultur des Schweigens, in der niemand Probleme offen ansprechen will, aus Angst, als leistungsschwach gebrandmarkt zu werden.
Besonders gravierend sind die Vorwürfe im Umgang mit ADA-Unterstützungsanfragen (Americans with Disabilities Act). Der Mitarbeiter, bei dem ADHS diagnostiziert wurde, bat auf ärztliche Anweisung explizit um klare Anweisungen und ein Mentoring-Programm – beides wurde ihm verwehrt. Stattdessen wurde er auf unzureichende Dokumentation und nicht funktionierende KI verwiesen und für die daraus resultierenden Verzögerungen persönlich verantwortlich gemacht.
Pikanterweise bestätigt Microsofts eigener "Work Trend Index 2025" diesen Trend: Eine wachsende Zahl von Mitarbeitern nutzt KI, um menschliche Interaktion zu vermeiden – aus Angst vor Verurteilung (17 %) oder um Kollegen nicht um Hilfe bitten zu müssen (16 %). Microsoft scheint diese Kultur der sozialen Vermeidung und des Verbergens von Problemen aktiv zu fördern.
Der wahre Treiber? Wie das US-Steuerrecht Massenentlassungen belohnt
Abseits von KI und Performance-Druck gibt es einen weiteren, sehr handfesten Grund für die Entlassungswellen: kaltes, steuerliches Kalkül. Jüngste Änderungen im US-Steuerrecht (u.a. der "Tax Reform Act of 2025" und der "Inflation Reduction Act") schaffen massive finanzielle Anreize für Unternehmen wie Microsoft, Personal abzubauen.
In der Praxis bedeutet dies: Hohe, einmalige Abfindungszahlungen können sofort von der Steuer abgesetzt werden. Dies senkt die Steuerlast im laufenden Geschäftsjahr so erheblich, dass es für den Konzern finanziell vorteilhafter sein kann, tausende Mitarbeiter zu entlassen, als sie weiter zu beschäftigen – trotz Rekordgewinnen. Die Entlassungen sind somit nicht zwingend ein Zeichen von wirtschaftlicher Not, sondern können auch ein Instrument zur aggressiven Steueroptimierung sein.
Das Game Pass-Dilemma: Ein "unhaltbares Modell" als tickende Zeitbombe?
Parallel zu den internen Verwerfungen rückt eine seit langem schwelende, fundamentale Frage wieder in den Fokus: Ist das Geschäftsmodell des Game Pass selbst Teil des Problems? Während Spieler das umfangreiche Angebot zu einem niedrigen Preis schätzen, warnen Branchenveteranen seit Jahren vor der mangelnden Nachhaltigkeit dieses Ansatzes. Die aktuellen Ereignisse verleihen ihren Warnungen neues Gewicht.
Der prominenteste Kritiker ist hierbei Raphael Colantonio, Gründer der ehemals zu Microsoft gehörenden Arkane Studios. Er bezeichnete das Modell als eine Gefahr für die gesamte Industrie.
"Es ist ein unhaltbares Modell [...], das der Branche seit einem Jahrzehnt zunehmend schadet. [...] Gamer mögen es, weil es ein gutes Angebot ist, aber sie werden es hassen, wenn ihnen die Auswirkungen auf die Spiele bewusst werden."
- Raphael Colantonio, Gründer der Arkane Studios (X)
Die Kernkritik lautet: Microsoft subventioniert den Game Pass massiv, um Marktanteile zu gewinnen und die Konkurrenz auszustechen. Kreativität und ambitionierte Projekte, die hohe Budgets erfordern, geraten in einem solchen Modell unter Druck, da alles einer Kosten-Nutzen-Analyse unterworfen wird. Auch Larian-Chef Swen Vincke (Baldur's Gate 3) warnte, dass bei einer Dominanz von Abos "gute Inhalte schwieriger zu bekommen sein werden".
Die aktuellen Entlassungen könnten nun als Beleg für diese düstere Prognose gesehen werden. Wenn ein derart aggressiv subventioniertes Modell nicht die erhofften, schnellen Gewinne abwirft, muss an anderer Stelle radikal gespart werden – bei den Studios und den Entwicklern, die die Inhalte für ebenjenen Service produzieren. Die Radikalkur bei den Personalkosten erscheint so auch als ein mögliches Symptom eines Geschäftsmodells, das auf lange Sicht finanziell nicht tragfähig ist.
Kommentar: Der Lack ist ab
Die anfängliche Bestürzung über die Entlassungen bei Xbox und die Einstellung von Projekten wie Perfect Dark ist einer tiefen Ernüchterung gewichen. Die neuen, detaillierten Vorwürfe des ehemaligen Mitarbeiters zeichnen, sofern sie zutreffen, das Bild eines Konzerns, dessen Seele von einer kalten, unethischen und zutiefst zynischen Management-Kultur zerfressen scheint.
Hier geht es nicht mehr um strategische Neuausrichtungen. Hier geht es um den Vorwurf systematischer Täuschung, um die Missachtung von Fürsorgepflichten gegenüber Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen und um die mutmaßliche Ausnutzung von Steuergesetzen auf dem Rücken der eigenen Belegschaft. Die KI wird dabei zum nützlichen Idioten – ein Vorwand, um eine Agenda der Kostenreduktion und Kontrolle durchzusetzen, koste es, was es wolle.
Für uns Spieler bedeutet das: Die eingestampften Spiele sind nur die sichtbare Spitze des Eisbergs. Darunter liegt offenbar ein Fundament aus Misstrauen und Angst, das auf lange Sicht kaum ein Nährboden für die Kreativität sein kann, die große Spiele hervorbringt. Der Glanz von Microsoft als Traum-Arbeitgeber hat tiefe Kratzer bekommen. Es stellt sich die fundamentale Frage, was die vollmundigen Bekenntnisse zu "Empowerment" und einer positiven Unternehmenskultur wert sind, wenn die interne Realität so drastisch davon abweicht.
Der Lack ist ab.
